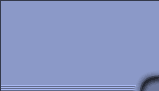|
Die Römer
in
Westfalen | 28 Jahre − von 12 vChr bis 16 nChr - waren die Römer rechtsrheinisch im Gebiet der westfälischen Bucht. Da römische Unternehmungen logistisch bis ins Detail durchgeplant waren, entstand entlang der Lippe - und aller Wahrscheinlichkeit nach - entlang des Haarweges, als Höhenweg vom Rhein über die Weser an die Elbe die kürzeste Verbindung, römische Infrastruktur. Wenn z.B. Tiberius (mindestens) zweimal an den Quellen der Lippe - das ist mit abnehmeder Wahrscheinlichkeit entweder Paderborn mit Neuhaus, Bad Lippspringe oder Kirchborchen an der Alme - überwintert hat [ Le i Abb 14 p 56 ], dürften seine (mindestens) vier Legionen in den (mindestens) sechs Monaten die Zeit zum Bau zahlreicher wasser- und städtebaulicher Anlagen genutzt haben:
Die Städte wurden jetzt gegründet,
schreibt Tacitus. | diese 28 Jahre
hätten
die Welt
verändern können |
Barenaue / Kalkriese
und die
Varusschlacht | 16 nChr scheiterte endgültig der römische Versuch, Germania Magna zur römischen Provinz zu machen. Die beiden wahrscheinlich ohne römischen Sieg verlaufenen Schlachten bei Idistaviso und am Angrivarierwall führten zu der endgültigen Aufgabe des Versuches – Cäsar Tiberius war Realist und gezwungen, die riesigen Eroberungen seiner beiden Vorgänger zu konsolidieren. Entscheidend für diese welthistorische Weichenstellung sind also die wechselhaft verlaufenen Ereignisse des Jahres 16 nChr und nicht die spektakulären clades variana des Jahres 9.
Verwunderlich ist, daß sich die Kalkrieser Ausgräber so heftig gegen die Identifizierung ihres Schlachtfeldes mit der Schlacht am Angrivarierwall wehren. Haben sie doch einen (mindesens) 400 m langen Wall an der Grenze zwischen Cheruskern ( südlich des Wiehengebirges ) und Angrivariern ( nördlich der Moore ) ausgegraben - der den Namen Wall verdient - und auch noch ein (mindestens) 700 m langes Grabensystem östlich davon bei Schwagsdorf [ BFSW ]. Bei Paul Höfer [ Höf pp 63, 77 ] findet man einen Vergleich der antiken Beschreibung des Schlachtfeldes der Schlacht am Angrivarierwall mit der Topographie bei Barenaue / Kalkriese - sie stimmen gut überein. Dazu leitet er drei Ortsnamen entlang des Rückzuges der acht Legionen Germanicus' von der Weser, zwischen Wiehengebirge und den Mooren, an die Ems, wo in etwa bei Rheine dessen Flotte ankerte, gemäßaus dem Schlachtgeschehen ab. Dabei ist im letzten Namen Wehr eine alte Form, die erst in neuerer Zeit durch Wall ersetzt wurde - also ein direkter Hinweis auf den Angrivarierwall, den es in Bezug auf die Varusschlacht nicht gibt. Die beiden ersten könnten die Stellungen der Römer und der Germanen festhalten.
Man vergleiche diese Herleitung mit der der ähnlich treffenden Kastellnamen Becking hausen und Anreppen an der Lippe. Letztere wurde durch H. Bücker auf das Anreppen römischer Schiffe zurückgeführt – überzeugend und lange vor der Entdeckung und Ausgrabung dieses römischen Versorgungslagers ❗
Und die wiederum mit der analogen Etymologie von Scheveningen an der holländischen Nordseeküste.
Außerdem weist Höfer auf Münzprägungen und -funde dort hin, die die gesamte frühe römische Kaiserzeit belegen, also auch die Zeit nach Augustus und Tiberius. Daß also zwar ein frühestes, aber kein spätestes Datum der drei Schlachten, welcher auch immer, durch Münzfunde belegbar sei. Die Masse der Münzfunde sei jedoch durch die napoleonische Besatzung geplündert worden. Selbst das dürfte nicht das erste Mal solcher Plünderungen sein, der 30jährige Krieg sollte zu ähnlichen Verlusten geführt haben. Das letzte Mal war es auch nicht, 1945 kam es nach dem Einmarsch amerikanischer Truppen wieder vor.
Und passend: Germanicus betrat 16 nChr das Schlachtfeld des Varus
nicht fern 
des Landes der Brukterer zwischen Ems und Lippe, das er vorher verwüstet hatte – nicht fern kann doch allenfalls der Tagesmarsch einer Legion sein, also weniger als 18 km.
Widerspruch: Tacitus' Beschreibung des Rückmarsches der vier Legionen Caecinas vom Schlachtfeld des Varus an den Rhein widerspricht den Kalkrieser Örtlichkeiten:
Zu beiden Seiten lagen allmählich ansteigende Waldstücke, die jetzt Arminius besetzt hielt
[ Le i p 181 ]. Daß das Kalkrieser Schlachtfeld zwischen dem Bergwald des Wiehengebirges auf der einen Seite und Sumpf auf der anderen liegt, läßt sich damit nicht vereinbaren und wäre den römischen Heeresberichten, auf denen die antike Geschichtsschreibung mit Sicherheit beruht, nicht entgangen. Daß es solche Heeresberichte gegeben haben muß, der Erfinder dürfte Cäsar gewesen sein, ergibt ein genauer Vergleich der Texte des Tacitus mit dem des viel späteren Zonares.
Kalkriese als Schlachtfeld des Jahres 9 ist mit den Ortsbeschreibungen der römischen Quellen - die gar nicht so spärlich sind - unvereinbar. Man muß vielmehr umgekehrt fragen, ob es überhaupt eine geographische Angabe in den Quellen gibt, die mit Kalkriese vereinbar ist. Einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt es jedoch nicht, nämlich diese Quellen für ungenau zu erklären – oder noch schlimmer, sie schlicht zu bezweifeln.
Genauigkeit: Wie überraschend präzise sie sind, zeigen jetzt die Beweise für vier markomannische Gefallene [ MS ] in Haltern, verscharrt in einem Töpferofen. Zunächst kann man daraus auf eine nicht nur lokale Bedeutung der zu unterstellenden Belagerung schließen. Jedoch ist selbst das, auch bei deren exakter Datierung auf 9 nChr ( oder auf 16 nChr ) immer noch kein Beweis für oder gegen Kalkriese als Ort der clades variana, allenfalls ein Indiz – dagegen! Denn wie sollten aus Kalkriese entkommene Legionäre nach Haltern gelangt sein, bei der Entfernung, unterstellt, die Schlacht hätte bei Kalkriese stattgefunden, und dieser Fund würde von der Belagerung Alisos nach der Schlacht stammen? Das gilt auch für die Gleichsetzung Haltern = Aliso: Germanische Angriffe auf römische Kastelle dürften in 28 Jahren römischer Präsenz häufiger vorgekommen sein. Die Entsorgung germanischer Gefallener in einem Töpferofen spricht sogar eher gegen eine Datierung auf die knappe Verteidigung des Lippekastells durch den Lagerpräfekten L. Caedicius, denn dieser räumte es ja anschliessend fluchtartig und schlug sich zum Rhein durch. Hätte er dann noch gefallene Gegner begraben, statt ihre Leichen, wie es üblich war, einfach über die Lagermauern zu werfen? Sie sind aber ein schlagender Beweis für die Genauigkeit antiker Geschichtsschreibung. |
alles
schon mal dagewesen
- und
durchdiskutiert
vor 150 Jahren
d.h.
gibt es überhaupt
ein Argument
- für oder wider -
das vor 150 Jahren
nicht schon einmal
diskutiert wurde?

umfassend
dargestellt
in
[ BFSW ]
[ LWI ]
[ LWK ]
und
[ LWM ] |
Ein
Römerlager
an der
Lippe
bei
Kesseler
| Kesseler an der Lippe ist der Ort eines weiteren Römerlagers - warum? Nachdem wir es selbst in GoogleEarth 2011 identifiziert haben, zeigen wir die Karte der bisher ausgegrabenen Römerlager [ Le i Abb 17 p 66, Abb 7 p 39 ] einigen Naturwissenschaftlern - alle tippen auf den selben Ort - zwischen den Lagern Oberaden und Anreppen. Es liegt genau nördlich der Stadt Soest an der Lippe. Auf dem Weg von Soest stoßen wir auf zwei einschlägige Ortsnamen – den Ortsteil Romberg in Östinghausen ( dort finden wir auf einer alten Karte im Stadtarchiv Soest auch einen einschlägigen Namen unten an der Ahse – Römerring ) und – Kesseler an der Lippe. Kesseler, erstmalig als Katteslare erwähnt, führt auf das lateinische castrum zurück. Etymologisch vergleichbar: In Mainz liegt das bekannte Römerlager auf dem Kestrich. Dies alles ist bekannt, siehe Schulten's Artikel [ Sch ] auf der Webseite von Felix Bierhaus aus Hovestadt. Dazu liegt im Burghofmuseum Soest ein Brückenpfosten aus Kesseler, der wegen seiner eisernen Armierung nur römisch sein kann. Leider wird dort kein dendrochronologisches Alter erwähnt. Das Internet liefert eine zweite Bestätigung: In GoogleEarth 2011 finden wir unmittelbar südlich der Lippe die für ein rechtsrheinisches Römerlager typische abgerundete, südwestliche Ecke [ Le i Abb 18 und 20 ].
Beschreibung des Römerlagers Kesseler: Direkt südlich der Lippe finden wir Altarme der Lippe, alle genau 20 m breit, aber letztmalig erst in jüngster Zeit so angelegt. Frage: Wurden dabei alte Muster übernommen? Das vermutlich genau rechteckige erste Lager liegt südlich einer Insel, die auch in neueren Straßenatlanten zu erkennen ist, im Feld genau hinter dem nördlichsten Hof von Niederbauer. Dabei ist klar, daß die Lippe ihren Lauf in den letzten 2000 Jahren immer wieder geändert hat. Ihr jetziger Lauf kann damals auch ein Seitenarm gewesen sein. Das durch seine südwestliche Ecke identifizierbare Römerlager halten wir für den ersten Anlauf eines Marschlagers ( wie in Anreppen gibt es auch hier ein Urkastell ). Das unten beschriebene größere Lager liegt auf der heutigen Südinsel und hat einen direkten Zugang zum heutigen Lauf der Lippe. Es ist kongruent mit dem in Beckinghausen ausgegrabenen Flußkastell. Dazu entlang des nördlichen Wasserlaufes ( der heutigen Lippe ) zwei runde Strukturen mit 5 m Durchmesser, der Form nach Fundamente der Türme eines Triumphbogens für den Cäsar Tiberius ( der sich mindestens in vier Jahren im rechtsrheinischen Gebiet aufhielt, zwei davon sogar über den Winter ). Der Abstand der beiden Türme beträgt etwa 15 m, die Steine daraus sind vermutlich dem Hausbau zum Opfer gefallen. Die runden Gruben sind in GoogleEarth 2011 klar zu erkennen. Sie könnten die alte Strasse durch ( Brücke über ) eine Furt der Lippe flankiert haben. Leider sind die Fundumstände des mit Metall beschlagenen römischen Pfostens aus dem Burghofmuseum Soest nicht mehr rekonstruierbar. Er kann genauso gut von einem Kai wie von einer Brücke oder einer anderen Wasserbauanlage stammen. Auf Felix Bierhaus' Webseite wird wenigstens der Fundort auf Kesseler eingeschränkt.
In der Kesseler Mühle hängt eine genaue Karte des Römerlagers in Kesseler ( Autor wahrscheinlich Frater Markus Hunecke OFM ), in die der Grundriß eines Flußkastells gezeichnet ist, der dem von Beckinghausen kongruent ist, also auch die Maße von etwa 200 × 100 m hat. Beschriftung und geographische Details stimmen aber nicht mit denen der Karte der Beckinghausener Ausgrabung überein, [ Ber ], [ Kue ] und [ Le i p 231 ]. Denn die Anzahl der ergrabenen Gruben ist nicht identisch. Der Autor, der offenbar ebenfalls diese Lage als Flußkastell angesehen hat, hat aber Glück gehabt. In GoogleEarth 2011 zeigen sich verblüffende Analogien: Nicht nur findet sich auch bei ihm der gleiche Grundriß, sondern auch gleiche Innenstrukturen. Lediglich gibt es in GoogleEarth eine Längslinie (=Straßengraben?) in West-Ost-Richtung statt dort zwei. Die Begrenzung dieses vermutlichen Flußkastells durch breite Gräben, die in der Aufnahme durch GoogleEarth teilweise ausgetrocknet sind ( es war also ein trockenes Jahr und die Pflanzendecke deswegen besonders durchsichtig ), kann Flurbereinigungen ( die gerade dort neue Linien erzeugt, aber auch alte übernommen haben kann [TK] ), Verlegungen, Begradigungen und vor allem natürliche Verlagerungen der Lippe durch die Frühjahrsüberschwemmungen überlebt haben, wie auch die durch die Gräben gebildete Insel. Ob die in GoogleEarth 2011 erkennbaren drei quadratischen Grundmauern schuppenartiger Gebilde an der Ostseite des Ur-Marschlagers alt zu erklären sind, bleibt offen – sie sind einfach zu gut zu erkennen. Allerdings erinnert sich niemand der heutigen Bewohner an Gebäude(reste) dort. Ein Rätsel können wir nicht auflösen: Fr. Hunecke bezeichnet die sehr detaillierte Karte als Ergebnis von Ausgrabungen bis 1937 / 38, [ Ber ] schreibt ebenfalls von (verlorenen) Ausgrabungen in Beckinghausen in diesen Jahren. Selbst diese Ungewissheit ist typisch für beide Lager! Sind sie von den selben römischen Pionieren, zeitlich überlappend angelegt worden? Ein modernes Beispiel: Den Fernsehturm Frankfurts hat die Baufirma DyWidAg ein zweites Mal in der saudischen Hauptstadt Rhiyadh gebaut, mit der selben Crew. | das Römerlager
liegt genau da
wo man es
vernünftigerweise
vermutet |
Ein Ring
von
sechs
Außen-
posten | Außenposten des Römerlagers Kesseler: Wichtige Orte haben die Römer durch Außenlager geschützt [ Le i ], ganz besonders natürlich in den noch nicht befriedeten rechtsrheinischen Gebieten. Also ist mit einem Ring solcher Lager um das Zentrum ( mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ) Kesseler zu rechnen, die durch Straßen miteinander und zum Zentrum Kesseler an der Lippe verbunden waren. Auch wechselseitige Sichtweite war unumgänglich. Diese machten das Zentrum fast unangreifbar. Ein wichtiges weiteres Prinzip war die militärstrategisch offensive Anlage dieser Lager: Im Gegensatz zu germanischen Anlagen, die geographische Besonderheiten defensiv nutzten ( z.B. Schutz durch Wasserläufe, Abhänge oder Ähnliches auf mehreren Seiten ) lag vor römischen Mauern möglichst offenes Feld – mit der Intention, den Feind dort zum Aufmarsch zu verleiten. Das erklärt auch die der runden überlegene, rechteckige Form römischer Kastelle: Der Feind wird auf engerem Raum fokussiert. Laut der antiken Quellen marschierten die römischen Truppen bei drohenden Angriffen dann ebenfalls vor den Mauern auf, in der - richtigen - Annahme der Überlegenheit römischer Strategien ( z.B. der Schildkröte ) und Waffen ( z.B. des Pilums, des Kurzspeers ): Bei Seesen wurden 2009 die Relikte einer römischen Version der Stalinorgel im Boden gefunden - eine aus Katapulten mörserartig abgeschossene Salve schwerer Eisenpfeile, gegen die auch keine Schilder mehr halfen. Wenn sich dann hinter diesem offenen Feld weitere natürliche Barrieren befanden, wurde die strategische Lage des Angreifers fast schon aussichtslos, und es drohte ein Schicksal wie das des Vercingetorix' bei Bibracte. | wir unterschätzen
in der Regel
das Ausmaß
römischer Anlagen |
| | Als Ring von Außenlagern kommen die folgenden sechs Orte in Betracht: | |
Romberg
. | An erster Stelle ist das Lager in Romberg, einem Ortsteil von Östinghausen, zu nennen. Dort finden wir auf einer Hochebene einen geraden, etwa 200 m langen Wall in Ost-Westrichtung mit nördlich vorgelagertem (Spitz)graben zwischen einem ebenen Feld und einem Neubaugebiet, das den Rest weiterer Anlagen überdeckt. Leider sind keine der typischen Eckrundungen im Gelände sichtbar, entweder waren dort Tore oder der Wall ist überbaut worden. 2011 wurde er an einer Stelle der Grundstücksgrenze angeschnitten, wobei sich sein Aufbau aus Erde abzeichnete. Er ist gerade so breit, daß sich zwei Reihen Palisaden unterbringen lassen, die durch Querbalken und eine Füllung aus Steinen ein starkes Bollwerk ergeben. Reste solcher Palisaden lassen sich nur durch eine Ausgrabung nach Art derer in Kalkriese [ BFSW ] und Kneblinghausen nachweisen. Dieser Wall unterscheidet sich also von dem in Kalkriese ausgegrabenen und ist dem des Lagers Kneblinghausen vergleichbar. Der Graben ist verfüllt, und - da die Bauern ihn kaum nutzen können - jetzt mit Büschen bewachsen. Auf dem großräumigen Lagergelände gab es vor der Bebauung einen Pfuhl, den wir als Reste der Zisterne deuten. Der Römerring unten an der Ahse könnte den Übergang der Straße nach Soest markiert haben, östlich der heutigen. Der Bleibarren, der auf dem Gut Kamen in Heppen gefunden wurde [ Pet ], und als römischer Import unwahrscheinlich ist, dürfte im Weichbild dieser Nord-Süd-Verbindung verloren gegangen sein. Die Entfernung zwischen dem Lager Romberg und dem an der Lippe ist etwa 2,5 km, also die gleiche wie zwischen Oberaden und seinem Flußkastell Beckinghausen. Es ist kaum noch festzustellen, ob Kesseler oder Romberg Hauptlager waren. Wahrscheinlich mußten zur Zeit der Schneeschmelze die Flußkastelle geräumt werden, Anreppen etwa in das ( noch nicht nachgewiesene ) Lager Paderborn.
Auf einer neuen Umgebungskarte am östlichen Ortsausgang von Herzfeld finden wir genau in der Mitte zwischen Kesseler und Rommersch, alle drei auf einer Linie mit jeweiligen Abständen von etwa 2,5 km liegend, den Flurnamen Romberg nochmal, auf einer leichten Anhöhe gerade südlich der Lippeniederung. Allerdings ist er auf den Flurkarten des Katasteramts Soest nicht erwähnt. GoogleEarth 2011 zeigt dort ein relativ großes, trapezförmiges Feld, in der Süd-West-Ecke durch einen Hof überbaut. | ein schönes Modell
eines ausgegrabenen
Spitzgrabens
findet man im
Stadtmuseum Oberaden
und in
Anreppen
für einen Nachweis
würde also schon
ein Schnitt
durch diesen Graben
in Romberg
ausreichen |
Rommersch
und
Tamfana | Rommersch ist der zweite Außenposten etwa 5 km flußabwärts von Kesseler Rommersch, östlich von Lippborg, dessen Namen selbst die genaue Übersetzung des lateinischen castra lupia ist ( diese Übersetzung ist so alt, daß kaum eine Quelle angegeben werden kann [Sca] ). Castra lupia kann aber auch phonetisch in Kesseler stecken. Auch der Name Rommersch ist einschlägig, denn Mersch bedeutet im westfälischen einfach Wiese am Fluß. Etwa 500 m flußabwärts von dort finden wir eine kreisrunde Vertiefung auf einer Fast-Insel in der Lippe, die wir ebenfalls als Grube der Fundamente eines (Aussichts-)Turmes deuten, aus der die Steine entfernt wurden. Wir halten es für wahrscheinlich, daß die Römer auch hier eine Furt durch eine Brücke ersetzt haben, wie in Kesseler – um Brückenzoll von den Pilgern aus dem Norden nach Tamfana zu verlangen. Die römischen Quellen berichten, daß Abgaben und Zölle zu den wesentlichen Ursachen des germanischen Aufstands unter Arminius gehörten.
Tamfana war ein germanisches Heiligtum, das durch Germanicus endgültig zerstört wurde und vermutlich im heutigen Ort Fahnen bei Borgeln lag. Dabei liefert eine Flurkarte von 1828 [Übersicht 1597 Fahnen] im Katasteramt Soest keine einschlägigen Flurnamen beim heutigen Fahnen. Auf dem östlichen Ufer des Soestbaches jedoch, etwa einen km entfernt in die Flur II Zumkotten, findet man einen Burgberg mit einer nach Süden weisenden Flur Steingraben, vom heutigen Fahnen aber durch das versumpfte Bett des Soestbaches getrennt. Diese Flurnamen treffen nicht genau – weshalb man für eine Lokalisierung von Tamfana eher annehmen muß, daß das Heiligtum unter dem durch einen Wassergraben geschützten Gut ( früherer Eigentümer Löser ) oder daneben in der Flur Fahnenheide lag, und von Germanicus restlos beseitigt wurde. Diese Lokalisierung bleibt aber umstritten, [ Der ], [ Skm ] suchen Tamfana näher bei Essen. | |
Die
Quabbenmühle
. | Ein drittes Außenlager vermuten wir an der alten Landstraße von Lippborg nach Beckum auf der rechten Seite ( Aussagen von dort Ansässigen ). Der ideale, überflutungssichere Standort dort wäre aber die Anhöhe oberhalb der Quabbe, wo heute fünf Straßen aufeinander treffen und eine Kapelle steht. In dem kleinen Waldstück finden wir einen steilen Abhang, der die Lagergrenze markiert haben könnte, und der durch künstliche Aufschüttungen für die modernen Straßen nach Osten und Süden fast verschwunden ist. Einen eigenen Flurnamen gibt es hier nicht – das Lagergelände liegt direkt oberhalb der Quabbenmühle. Weiter nördliche Standorte zwischen der Straße Dalmer ( von Lippborg nach Hawixbrock ) und der alten Landstraße nach Beckum dürften kaum noch im Kontext Kesselers zu sehen sein, sie sind rund und haben damit nicht die Gestalt eines Römerlagers, und sie sind schon zu weit entfernt. Aber den Namen Quabbe in Bezug zur Römerzeit zu setzen [ Büc ], ist genauso weit hergeholt, wie den Lindwurm des Siegfriedliedes mit dem Heereswurm des Varus zu identifizieren, selbst wenn Arminius ein lateinischer Kriegsnamen ist und die ältere Generation seiner Familie alle den Namen Seg → Sieg in ihren Namen führen! In Quabbe steckt ein (vorindogermanischer?) Gewässernamen apa [ Ven ]. | |
| Dabrock | Das vierte Außenlager vermuten wir nordwestlich von Kesseler an der Straße Dabrock in der Flur Pferdekamp, von Kesseler aus dem Gradienten der Anhöhe folgend. Das Terrain dort ist hochwassersicher und nach Norden durch wässrige Niederungen des Alps- und des Bröggelbaches geschützt, die heute durch Entwässerungsgräben trockengelegt sind. Die Fortsetzung des Weges, allenfalls als Knüppeldamm durch diese beiden Niederungen möglich, traf dann auf die typisch germanische Bröggelburg nördlich des Bröggelbaches. Erst ab da war eine Fortsetzung als Höhenweg in Richtung der Beckumer Berge möglich. Das Lager liegt in Sichtweite von Kesseler, Rommersch und dem an der Quabbenmühle. Man kann vermuten, daß die Ortsnamen Romelik und Romelshof, von denen Schackmann [ Skm ] berichtet, hierher gehören oder zu den beiden westlich davon liegenden Außenlagern. | |
Hovestadt
. | Als fünften Außenposten müssen wir Hovestadt annehmen. Das dortige Schloß ist auf Pfählen im Sumpf erbaut und scheidet deswegen als Standort eines römischen Wachpostens aus, ebenso wie die umliegenden Wiesen. Hafen bzw. Anlegestelle an der Lippe sind vermutlich etwas flußaufwärts zu suchen. An der engsten Stelle müßte entweder in Herzfeld oder in Hovestadt ein Wachturm gestanden haben, in Sichtkontakt mit Kesseler, der aber überbaut sein dürfte. Ein Flußkastell der Größe Kesselers darf man hier nicht erwarten. Da der genaue Verlauf der Lippe in jener Zeit aber nicht bekannt ist, müßte der Ausgangspunkt für Untersuchungen immer der Anlegeplatz sein. Wegen der breiten Talaue, ( Herzfeld nördlich und Hovestadt südlich der Lippe sind in den Köpfen auch heute noch nicht wirklich vereinigt ), ist ein Übergang über die Lippe hier sehr schwierig, was den Nord-Süd-Verkehr auf Kesseler konzentriert haben sollte. Die Talenge ist geologisch interessant. Nach der letzten Eiszeit dürfte hier eine Barriere gelegen haben, die das obere Lippetal in einen großen See verwandelt hatte. Der Durchbruch dürfte dann erst im Laufe der Zeit passiert sein, und an den Engen muß man auf den Rändern entlang der ganzen oberen Lippe mit römischen Wachtposten rechnen, einige schon Außenlager der größeren Lager. | |
Remlingsberg
| Auf dem Remlingsberg zwischen Westlarn und Brockhausen ( 500 m östlich von dort ) vermuten wir das sechste Außenlager: Auf den Umgebungskarten in Bad Sassendorf wird er so genannt, auf den Flurkarten von 1828 ( also noch vor der Flurbereinigung ) im preußischen Urkataster des Katasteramts Soest [ Karte 1698 Brockhausen, 2te und 3te Flur ], findet man auch die Namensform Remmelsberg - ebenfalls überflutungssicher hoch zwischen Rosenau und Ahse und in Sichtweite von Hovestadt und Romberg. Der etwa 5 m hohe Abbruch im Westen dürfte später durch Abgraben der Erde entstanden sein, was den westlichen Teil des Lagers beseitigt haben dürfte. Sehen wir unmittelbar am Abhang ein Nordtor mit einer Rampe? Das von der Beackerung ausgesparte, bewaldete Rechteck nördlich, das auf dieser alten Karte nach Norden, westlich des Sauerlandgutes, in schmalen Fluren seine Fortsetzung über einen schmalen Bach bis an die Ahse hat, halten wir für Reste einer breiten Römerstraße nach Hovestadt. Als Winterlager ist dieser Standort ebenso geeignet wie Oberaden, Romberg oder Paderborn.
Die sechseckige Anlage mit einem Durchmesser von 200 m, eingeklemmt zwischen diesem Waldstück und dem Remlingsberg, deren Grundriß in GoogleEarth 2011 gut zu erkennen ist, läßt sich kaum römisch interpretieren, dürfte aber auch nicht aus jüngster Zeit stammen. | |
| | Keinen Außenposten sehen wir in etwas größerer Entfernung nördlich von Herzfeld, schon nördlich des Bröggelbaches, in der Flur 38 die Namen Berghege und Landwehr, mit darin enthaltenen Wassergräben. Dort liegt eine der größten, vermutlich mittelalterlichen Landwehren Westfalens. Es bleibt zwar eine breite Lücke zwischen Dabrock und Hovestadt im Ring der Außenposten Kesselers offen, aber die Ebene ist durch Alps- und Bröggelbach ähnlich wasserreich und versumpft [ Bra p 123 ], wie die Senne nördlich von Paderborn. | |
| Soest | Soest ist unter dem Namen Sosat, latinisiert Susatum, erstmalig schon vor dem Jahr 1000 erwähnt und durch seine Quellen ausgezeichnet. Soest liegt ebenfalls in gegenseitiger Sichtweite mit Romberg und dem Remlingsberg. Den ersten Grundriß von vor dem Jahr 1000 findet man in [ Nuh ]: Trapezförmig mit abgerundeten Ecken ist auch hier die (fast) rechteckige Form eines typisch rechtsrheinischen Römerlagers zu sehen ( daß Grundrisse wichtig sind, hat Werner Le i überzeugend dargestellt ).
Wahrscheinlich haben die Römer auf ihrem Weg an Weser und Elbe, dem Haarweg ( der die kürzeste Verbindung ist ), zum Wasserweg der Lippe diesen Ort befestigt, der aber in [ KMKL ] nicht nachgewiesen wird. Es wäre nur zu klären, warum in den 1000 Jahren nach den Römern die Stadt Soest nicht über diesen Grundriß hinaus gewachsen ist. Vermutlich liegt das einmal an der Abwanderung der Sachsen in das nordfranzösische Reich der Franken, vor und nach Chlodwig im Rahmen der Völkerwanderung, und nach England. Es ist bekannt, daß sich zu dieser Zeit z.B. das Alte Land zwischen Stade und Hamburg fast vollständig entvölkert hat, und es gibt in Frankreich Ortsnamen, die sich auf Sachsen zurückführen lassen. Anders als in England gibt es dort aber kein geschlos senes sächsisches Siedlungsgebiet mit sächsischem Recht.
Die zweite große Abwanderung und sogar Vertreibung hat unter Karl dem Großen stattgefunden, im Rahmen der gewaltsamen Unterwerfung der Sachsen. Soest dürfte damals fränkisch geworden sein – das benachbarte Sassendorf blieb sächsisch und drückte dies im Namen aus. | |
Römer-
straßen | Das Wegenetz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, nicht nur, aber entscheidend auch bei den Römern. Nachdem durch den spektakulären Fund des Mannes vom Similaun genau auf der Wasserscheide zwischen Nord- und Südtirol nochmal die Existenz sehr früher Fernwege betont wird, ist es vernünftig, auch für die 28 Jahre römischer Besetzung der westfälischen Bucht ein voll entwickeltes Wegenetz zu unterstellen.
Für die Zeit davor kann man nur annehmen, daß die indogermanische Einwanderung aus dem Osten nach Europa ohne Wege und deshalb nur langsam vor sich ging, während das eigentliche Fernwegenetz im Westen schon durch die vorindogermanischen Glockenbecherleute eingerichtet wurde. Dabei folgen wir W. Le i se, daß der direkte Weg vom Rhein an die Weser parallel zum Wasserweg der Lippe über den Haarstrang verlief, und in der westfälischen Bucht kein weiterer West-Ost-Landweg existierte. Bei Schackmann [ Skm ] kann man nachlesen, wie die Suche nach solchen West-Ost-Wegen ( von Dolberg über Wintergalen durch den Hunolt 15 km nördlich von Lippborg ) fehlschlug, obwohl solche in der mündlichen Überlieferung vorhanden waren ( Kalkriese liegt ebenfalls an einem Fernweg von der Ems an die Weser ).
Der Hellweg dürfte erst nach der Völkerwanderung entstanden und der heutige Fahrradfernweg, die Römerroute, eine Erfindung aus sogar allerjüngster Zeit sein, und allenfalls Anreppen mit dem noch zu findenden dortigen Hauptlager des Varus verbunden haben.
Damit werden lokale Nord-Süd-Verbindungen vom Wasserweg der Lippe zum Haarstrang notwendig. Eine solche dürfte von Kamen ( aus lat. camino ≡ Weg ) zum Haarweg geführt haben [ Le i ]. 50 km östlich und parallel dazu verläuft für Kesseler ( nördlich siehe unten ) eine solche Verbindung nach Süden über Romberg ( östlich der heutigen Ahsebrücke - hier gibt es genau eine günstige Stelle ), immer einer Höhenlinie östlich der Schledde folgend, westlich Brockhausen ( dort einen km entfernt vom Remlingsberg ) und Heppen / Kutmecke ( am Gut Kamen, das im Namen diesen Weg festhält ). Dieser Weg hieß in historischen Zeiten Salzweg, so eingezeichnet in alten und modernen Karten ( z.B. in der Kesseler Mühle ), man suche ihn in [DTK] und [TK]. Die Sassendorfer Salzquellen waren natürlich ( nicht nur ) für die Römer äußerst attraktiv. Salztransport in die Mühle macht natürlich Sinn, denn dort konnten Kähne den Weitertransport übernehmen. Keinen Sinn macht aber die Fortsetzung von Kesseler nach Dabrock, es sei denn für die Römer als Verbindung zum dortigen Außenposten.
Dort war in nachrömischen Zeiten nichts mehr, warum sollte man also Salz dorthin transportieren? Westlich und östlich des Salzwegs dürften zwei weitere Nord-Süd-Verbindungen verlaufen sein. Die westliche Parallele kommt aus dem Bruktererland im Norden [ Skm ] zum Außenlager an der Quabbe und quert die Lippe am Rommersch. Von der Quabbenmühle bis zum Rommersch dürfte der Weg trocken dem linken Hochufer der Quabbe gefolgt sein, dann durch Lippborg bis Rommersch leicht abfallend. Über Lippe und Ahse geht es weiter nach Zumkotten und, dem Soestbach folgend, trocken auf einem Höhenweg nach Soest.
Nach Fahnen muß allerdings die Niederung des Soestbaches nach Westen überbrückt werden. Ein Standort des Heiligtums östlich des Soestbaches würde diese Querung überflüssig werden lassen. ( Wenn die in der Überlieferung vorhandene, obige Römerstraße im Hunolt bei Assen, statt von West nach Ost, von Nord nach Süd verliefe, würde sich ein Detail bei Schackmann [Sca] überraschend leicht aufklären - die in einer Chronik des Stadtarchivs Beckum für das Jahr 1808 berichtete Ausgrabung der Steine des Quadrates einer preussischen Rute - 3,77 m - eines Straßenstückes ). Die östliche Parallele dürfte von Hovestadt über den Remlingsberg den mittleren Weg bei Brockhausen erreicht haben. Alle diese Wege sind Höhenwege, also trocken.
Einziger Beweis für dieses lokale Netz bleibt der römische Brückenpfosten im Burghofmuseum – der Bleibarren vom Gut Kamen ist nur ein Indiz.
Durchgesetzt hat sich die Theorie von den Höhenwegen allerdings noch nicht [ Joh p 107 ]. | Römerfernstraßen
verlaufen auf
älteren Fernwegen
Rhein-Weser-Elbe,
die wahrscheinlich
schon von den
Glockenbecherleuten
genutzt wurden
West-Ost Fernwege
gibt es nur auf
dem Haarstrang
und dem Plackweg
weiter südlich,
alle anderen
sind nur lokal
Nord-Süd-Verbindungen
gehen vom
Wasserweg der Lippe
zum Haarstrang |
| Häfen | Boote fuhren auf der Lippe, Flachbodenschiffe nachgewiesener Maßen bis Anreppen, wo große Magazinbauten und ein halb weggeschwemmter Hafen ausgegraben wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar bis Neuhaus, wo am Kloster, der Mündung der Pader in die obere Lippe, ein idealer Anlegeplatz liegt.
Auch die Alme dürfte für flache Boote, die dem Bleitransport dienten, bis auf die Höhe von Kneblinghausen schiffbar gewesen sein. Von Anreppen und Neuhaus aus wurde das Sommerlager des Varus verproviantiert - das muß man aus der schieren Größe Anreppens und seiner Magazingebäude schließen.
Das Römerlager Kesseler macht nur Sinn durch den Wasserweg, wie auch alle anderen Lippekastelle. Man darf sich aber darunter nicht zu wenig vorstellen, schließlich hat sogar ein römisches Kriegsschiff auf der Lippe operiert. Wenn Drusus 200 Kastelle entlang des Rheins bauen und einen Kanal vom Rhein an die Nordsee graben ließ, dann muß man den Römern auch wasserbauliche Maßnahmen an der Lippe zutrauen, dergestalt daß ohne weiteres eine Legion verschifft werden und lagern konnte.
Trotzdem trifft es der Begriff Anlegeplatz wohl besser. Solche haben bestimmt bestanden, in Haltern und Beckinghausen wurden sie ausgegraben, in Anreppen ist ein solcher durch Verlagerungen der Lippe wahrscheinlich halbiert worden. Dieses Schicksal könnte auch weitere Hafenanlagen an der Lippe getroffen haben. Sie haben die Germanen so beeindruckt, daß in zweien der Name bis heute überdauert hat. Technisch ist das vernünftigste, den Anlegeplatz in einen Seitenarm zu verlegen, bzw. den Fluß umzuleiten.
Wegen der Masse des zu transportierenden Materials einer Legion könnte man sehr wohl auch Anlageplätze an den beiden Außenposten Kesselers flußauf- und -abwärts vermuten, und zwei weitere größere, Kesseler / Romberg entsprechende, römische Lager, etwa 18 km flußab- und die gleiche Entfernung flußaufwärts. Genau da liegt der wiederum ideale ( weil hochwassersicher ) Standort Cappel [ Mnt ], seit fast schon 200 Jahren dort vermutet, aber archäologisch noch nicht nachgewiesen – was schwer zu verstehen ist.
Damit muß es auch eine römische Nord-Süd-Straße von Cappel zum Haarstrang gegeben haben, mit einer Fortsetzung nach Kneblinghausen / Arbalo, vermutlich zur Spitzen Warte, oder über Hemmern ( der Name läßt sich wie der von Kamen aus lateinischem camino ≡ Weg ableiten ), wo der Haar- in den Hellweg übergeht. Diese Nord-Süd-Verbindung kreuzt dann hier die Haupt-West-Ost-Verbindung vom Rhein an die Weser.
Cäsar Tiberius war folglich persönlich in Kesseler, denn eine Rückfahrt vom Winterlager
 an den Quellen der Lippe an den Quellen der Lippe
an den Rhein ist bequemer als der weite Ritt – und sicherer, wie das Beispiel des Todes Drusus' zeigt, der dem ältesten berichteten Verkehrsunfall zum Opfer fiel. Eine solche Flußfahrt bedeutet auch erheblichen Zeitgewinn und die Möglichkeit mit den Offizieren strategische Varianten festzulegen.
Zusätzlich nehmen wir an, daß auch deswegen Germanicus 16 nChr den Rückweg an den Rhein über Lippe und Haarstrang - wie schon den Hinweg - wählte und sich keinesfalls durch Arminius auf dem Weg zum römischen Flottenstandort an der Ems durch die Enge bei Barenaue / Oberesch locken lies. Strategisch war Germanicus - immerhin leiblicher Sohn des strategischen Genies Drusus - ein anderes Kaliber als der korrupte Varus! Zudem kannte er die Strategie Arminius' genau - was natürlich umgekehrt genauso galt. Den Weg an die Ems nahm allenfalls eine römische Kohorte, die dann dort angegriffen wurde, aber dadurch den ungestörten Rückweg der Hauptarmee ermöglichte. Ihr Schicksal kann man nur vermuten - vergrabene Wertgegenstände konnten jedenfalls nicht geborgen werden. Damit ist die Schlacht am Angrivarierwall als Finte der Römer zu werten - um den ungestörten Rückweg an den Rhein zu sichern.
Ein Traum wäre es, eines der römischen Boote auszugraben, wozu vielleicht gerade wegen der vielen Lippeverlagerungen und der anstehenden Renaturalisierung des oberen Lippetals noch eine geringe Chance besteht. Keine gute Idee ist, das renaturalisierte Gebiet unter Naturschutz zu stellen und die Kanuten daraus zu vertreiben. Schließlich wurde das Schlachtfeld im Tollensetal bei Conerow / Weltzin vom Boot aus entdeckt - durch aufmerksame und historisch gebildete Amateure. | Tiberius
was here |
| Namen | Namen spielen sehr wohl eine wichtige Rolle - in vielen Gewässer-, Berg-, Flur-, Orts-, Gau- und Landesnamen steckt Überlieferung, die bis zur ersten Besiedelung Europas nach der letzten Eiszeit zurückreicht [ Tau ]: Personennamen dürften öfter aus diesen abgeleitet sein, als umgekehrt. Dies gilt natürlich nicht, wenn ein Ort auf der grünen Wiese gegründet wurde, etwa bei den Drususkastellen entlang des Rheines und denen an der Lippe. Dabei handelt es sich aber um Wahrscheinlichkeiten, wie das Beispiel Kneblinghausen zeigt: In [ Büc ] wird es mit Kanduon identifiziert ( dieses liegt nach [ KMKL ] bei Eisenach ), in [ Le i ] überzeugender mit Arbalo ( aus Arpesloh ≡ Wald am Rande des Arpesfeldes ), dem Ort an dem Drusus überfallen wurde. Diese Lokalisierung ist aber schon älter [ Bra ]. Erst die Häufung einschlägiger Namen liefert die Aussage. Zwei der bisher erschlossenen Römerlager der westfälischen Bucht wurden auf Grund der Flurnamen gefunden: Oberaden durch den Pfarrer Prein, nach Hinweisen von Esselen [ Ess ], sowie Kneblinghausen.
Nördlich von Kneblinghausen / Arbalo liegt in Sichtweite Hemmern, das sich aus dem lateinischen camino ≡ Weg übersetzen läßt, vermutlich an der Kreuzung einer Nord-Süd- mit einer verkehrsreichen West-Ost-Verbindung. Damit liegt es nahe, im Raum Büren / Wewelsburg ein weiteres Kastell mit kleinem Hafen zu suchen, der der Verschiffung des südlich geförderten Bleis an den Rhein diente und auch die Vermutung, daß die Römer die Alme als Oberlauf der Lippe ≡ lupia ansahen. Leise [Le i] vermutet einen Außenposten am Düsteren Born nahe (Kloster) Böddeke und weiter nördlich einen Hauptübergang über die Alme an der Furt von Niederntudorf. Für einen Bleieinschiffungshafen ist dies aber schon zu weit nördlich.
Auch wegen seiner wirtschaftlichen Bedeutung muß das Tal der Alme in die Aufdeckung der römischen Infrastruktur des Lippetals einbezogen werden.
Die römischen Kastelle an der Lippe dürften Neugründungen sein: Exploratores zogen aus um den militärstrategisch besten Platz zu finden, germanische Siedlungen lagen dann dort nicht unbedingt. Da z.B. Kesseler an der Lippe hochwassergefährdet ist ( genau wie Beckinghausen und Anreppen ), dürfte hier eine Neugründung stattgefunden haben mit einem Namen vom Typ castra lupia tiberii oder ähnlich. Aliso ist es jedenfalls nicht, denn es fehlt der Nebenfluß Elison. Als Aliso kommt eher Oberaden in Betracht [Lei], auch Haltern [ MS ] oder Cappel [ Mnt ]. Leises Ansicht halten wir für immer noch wahrscheinlicher. Dafür müßte sich jedoch die erste Silbe Ses im Flußnamen Seseke ( die zweite ist einfach beke ≡ bach ) etymologisch aus Elison herleiten lassen ( da die zentraleuropäische Hydronomie lange vor der indogermanischen Einwanderung entstanden sein dürfte, wäre Ses vorindogermanisch zu erklären, keinesfalls etwa keltisch ). Da ist die Herleitung Elison ↔ Liese bei Cappel dann schon überzeugender [Men]. Sprachlich ebenso naheliegend ist caput lulie → Cappel . Cappel dürfte schon im Zusammenhang mit dem noch nicht gefundenen Winterlager des Tiberius zu sehen sein, denn dessen vier ( oder waren es noch mehr ?) Legionen können nicht alle an einem Ort überwintert haben, sondern müssen über mehrere Lager verteilt gewesen sein. Einschlägige Ortsnamen häufen sich also nicht nur bei Kesseler, sondern auch bei Cappel und südlich davon.
In Bezug auf die römischen Militäroperationen in germania magna sind die Ortsnamenso zu verstehen, wobei wir nur Kesseler eingefügt haben. Die linke Spalte stammt von Paul Höfer [ Höf ]. Allerdings sind nur Kesseler und Cappel aus dem Lateinischen eingedeutscht.
Schon die bloße Existenz eines Namens kann zu Schlüssen führen: Wenn die römische Geschichtsschreibung von einer Schlacht am Angrivarierwall berichtet, muß dieser Wall schon vor den römischen Legionären dort angelegt worden sein. Denn die Angrivarier von nördlich der Sümpfe um Barenaue gehörten nicht zur Koalition des Arminius, allenfalls waren einige abenteuerlich veranlagte junge Männer involviert, und das vermutlich auf beiden Seiten. Also muß dieser Wall schon vorher - zur Abwehr der nördlchen Angrivarier - von den südlichen Brukterern und Cheruskern - dort wo seit altersher ein Knüppeldamm durch die Sümpfe führte - gebaut worden sein. Hätten Legionäre Germanicus' diesen Wall im Verlauf der Schlacht aufgeschüttet, würde die römische Geschichtsschreibung ihn nicht nach den Angrivariern benannt haben! | Namen
sind
wichtiger
als ihr
Ruf
Kamen
Kesseler
Romberg
Rommersch
Remlingsberg
die
Häufung
ist die
Aussage |
Übersetzungen
der
Antiken Quellen | Richtig übersetzen ist gar nicht so einfach. Und gerade bei den für die Geschichte so wichtigen Ortsangaben ergeben sich Unsicherheiten. Alles klar ist noch bei nicht fern, wie oben schon dargestellt. Die oberste Grenze hierfür ist der Tagesmarsch einer Legion.
Aber was bedeutet in saltus teute burgensis ? Warum steht hier nicht das völlig eindeutige lateinische silva, wenn Wald gemeint wäre? Ist vielleicht doch was anderes gemeint - und was? Le i se übersetzt diesen Begriff mit im Wald der Volksburgen , also nicht als Eigennamen, der üblicherweise angenommen wird. Die Annahme, daß die römischen Geschichtsschreiber hier ein germanisches Wort übernommen haben, ist unwahrscheinlich. Man müßte das durch andere Beispiele belegen, sowohl beim gleichen Autor, wie auch bei anderen. Leise nimmt hier ein germanisches Teut mit der Bedeutung Volk an. Ist hier nicht lateinisch tutti / tota ≡ alle anzunehmen, parallel zum späteren Volksnamen der Alemannen? Dieses indogermanische Wort steckt nicht nur in deutsch, sondern auch in der 2000 Jahre älteren Eigenbezeichnung der Daker auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens. Dann macht es natürlich einen Unterschied, ob dieser Begriff zusammen oder auseinander geschrieben ist. Dazu müßte man die Urschriften der antiken Autoren einsehen. Ist also der Codex, der zunächst in Corvey war und jetzt in Rom ist, Ur- oder schon Abschrift?
Das dritte wichtige Wort der römischen Autoren ist caput. Es ist gemeinindogermanisch, vom germanischen Haupt nur durch eine Lautverschiebung getrennt. Hier ist wirklich Quelle gemeint, Mündung ist unwahrscheinlich. Aber ist es Ein- oder Mehrzahl? | richtig
übersetzen
es ist
keineswegs
alles geklärt |
Etymologie
und
Gewässernamen | Die Herleitung der Eigennamen ist wichtig - aber auch wacklig. Beinahe alles was sich nicht aus dem Germanischen erklären läßt, wird heute reflexartig aus dem Keltischen hergeleitet. Inzwischen ist aber unzweifelhaft, daß insbesondere die Gewässernamen weit älter sind, und diese Hydronimie wahrscheinlich sogar auf die Erstbesiedlung Europas nach der Eiszeit zurückgeht [ Ven ]. Dabei wurde meistens nicht übersetzt sondern nur übernommen. Schön ist Vennemanns Beispiel Lake Chiemsee, wo dann dreimal dasselbe steht, nur in verschiedenen Sprachen. Es ist also wahrscheinlicher, daß lateinische Bezeichnungen ins Germanische ( als Lehnwörter ) verballhornt wurden, als daß sie übersetzt wurden. Die Übersetzung Lippborg aus castra lupia ist also unwahrscheinlicher als die Germanisierung Kesseler. Dazu gibt es viele Analogien in Europa, zur reinen Übersetzung ins Deutsche nur wenige. Bei Le i se findet man eine Ausnahme: pontes longi identifiziert er mit dem Ortsteil Lange Brüggen in Kamen, Bücker [ Büc ] nimmt dafür Wiedenbrück an, passend zu seiner Lokalisierung der clades variana nördlich der Lippe.
Cappel bzw. Kappel ist als Ortsnamen in Deutschland recht häufig, und meistens auf eine frühe Kapelle aus späterer Zeit zurückzuführen. Dies schließt aber nicht aus, daß er schon unmittelbar nach dem Rückzug der Römer hinter den Rhein ins Germanische übernommen wurde, und daß dieses Beispiel sich dann später einbürgerte - wie vermutlich auch eine Menge anderer Lehnwörter und das Beispiel Kassel ( die römischen Funde seit 2008 kreisen Kassel regelrecht ein - ist da auch was ❓).
Die Klärung der westfälischen Hydronomie steht noch aus. Für die Identifizierung des Elisons bei Aliso wäre eine Etymologisierung aller Gewässernamen wichtig, also der Pader, Heder, Ses(ecke), Senne, Günne, Liese, Schledde, Ahse, Alme, des Alps+ ( man findet auch Alp+ ), Bewer+, Bröggel+, Hauster+, Gieseler+, Trotz+, und Soestbaches ( hier also auch des Ortsnamens Soest ), ... in der engeren Umgebung, etwas weiter dann Diemel, Ems, Möhne, Ruhr ... . Ist das deswegen noch nicht gelungen, weil Vennemanns Herleitung aus einer Urform des Baskischen nicht in Erwägung gezogen wurde, sondern nur das Keltische? Und genau deswegen nichts herauskam ❗ | die
systematische
Etymologie
westfälischer
Flußnamen
steht noch aus |
| Olfen | 2011 wird bei Olfen das noch ausstehende Römerlager halbwegs zwischen Haltern / Beckinghausen und Oberaden entdeckt. Den Anwohnern war der römische Sachverhalt aber immer bekannt! Es liegt auf eimem hohen Bergsporn, dem nördlichen Prallhang der Lippe, in einem landwirtschaftlich genutzten Feld, in einer typisch römischen Umgebung, die der von Kneblinghausen ähnelt. Es soll unter Drusus nur vier Jahre genutzt worden sein. Aber unter Varus und Tiberius wäre es als Etappenlager noch wichtiger gewesen, genauer - solange Anreppen bestand muß auch Olfen bestanden haben.
Ist es also verlegt worden? Wenn ja, weit kann es nicht sein, aber vergleichbar günstige Lagen sind in der Nähe nicht sichtbar. Auch wäre dann noch das zugehörige Flußkastell, der Anlegeplatz unten an der Lippe zu finden - in maximal 2,5 km Entfernung, mit der Schwierigkeit, daß das damalige Flußbett kaum mit dem heutigen übereinstimmt. Als Aliso kommt es nicht in Frage, es gibt hier keinen Fluß Elison.
Wenn wir Haltern und Oberaden als größere Militärkomplexe ansehen wird die Deutung des Namens Olfen aus dem westfälischen Platt half + loh, nämlich auf halbem Wege + Gehölz / Wald, plausibel - und Bischof W + olf + helm hätte dann seinen Namen vom Ort seiner Herkunft ulf + loa bekommen.
Damit fehlen nur noch die beiden Lager bei Kesseler und Cappel, und [ Kr t ] die römische Infrastruktur Lippe aufwärts wäre vollständig. Aber selbst wenn dies nun endlich auch archäologisch gelänge, würde sich wieder die Frage nach dem Sinn dieser Kette von Lagern stellen. Wenn Anreppen nur ein Hafen mit Stapelplatz war und damit als Winterlager des Tiberius bzw. Sommerlager des Varus ungeeignet - wo dann lagen diese? Damit würde Leises Identifizierung Paderborns mit diesem(n) Lager(n) noch wahrscheinlicher. | neueste Entdeckungen |
Idistaviso
und
die Schlacht
am
Angrivarierwall | Wir schließen uns also W. Leises Idenfizierung der Clades Variana bei Brilon an und müssen deswegen auch eine Meinung zu den beiden Schlachten bei Idistaviso und am Angrivarierwall bei Barenaue / Kalkriese entwickeln. Sprachlich liefert
| | | | | | Tabelle Idistaviso |
| Schlachtort | | semitisch / arabisch | | Übersetzung | Kommentar | [ Quelle ] |
| ☟ | | ☟ | | ☟ | ☟ | ☟ |
I d i
+sta+
v i so | ⭮ | i ˁ t i dā ˀ
wašy | ≡
≡ | Angriff, Überfall
jemand betrügen |
ist eine übliche Vorsilbe
also ein Scheinangriff ❓ | [ WrC p 599,
p 971] |
| - hier könnte man auch waḥš i ≡ wild, brutal einsetzen [WrC p 1056], bekäme dann aber eine ganz andere Interpretation dieser Schlacht und ihres Ortes - und völlig überraschend |
| |
I d i
+stav i s
+o | ⭮ | i ˁ t i dā ˀ
sta wḥaš
| ≡
≡
| Angriff, Überfall
etwas (ver)missen
|
in irakischem Arabisch
Standardendsilbe in Namen |
[ Qaf p 623 ]
[ Germanisch ] |
| - und genauso überraschend, daß die erste Silbe - nur etwas weiter ausgelegt etwa Kampf, Krieg - auch in der Gravur auf dem Runenstein nahe des norwegischen Svingerud als -berug oder -berun vorkommt und auch durch den zweiten, lesbaren Teil dieser Inschrift überzeugend semit(id)isch übersetzt werden kann |
| | baarač
brg | ≡
≡ | segnen, niederknien
glänzen |
etwa nach schwerem Kampf | [ Qaf p 36
p 39 ] |
| - worin man auch den häufigen, einschlägigen hebräischen Nachnamen Baruch heranziehen kann - oder - vergleiche mit Brandenburg - |
| | barraan i
ba r i-i i n | ≡
≡ | außerhalb
Fremde (Plural) |
etwa Überfall / Angriff von ... | [ Qaf p 37
p 35 ] |
| - in beiden Übersetzungen mit |
| | i st i brā ᦱ
barra | ≡
≡ | Zeremonie für etwas
hingegeben, geweiht |
also etwas Weihevolles | [ WrC p 50
p 49 ] |
| als Kern - jedenfalls eine jeder anderen aus einem erfundenen, nichtüberlieferten Namen überlegene Etymologie -
für einen Gedenkstein spricht auch die äußerst zentrale Lage
des Runensteins nördlich von Oslo - letzten Endes
ein prähistorisches Arlington ❗
Selbst die beiden einschlägigen Schreibweisen -berug oder -berun können eine Erklärung haben - entweder war der Steinmetz im Lesen von Runen nicht sonderlich bewandert, oder er war es und konnte durch kreatives Abändern einer Rune beides unterbringen.
Einschlägig lassen sich auch die Namen der drei Orte nördlich von Oslo |
| Svin+gerud | ⭮ | zayyan+gard | ≡ | zieren [ig] + Ort | beflügelt die Vorstellung | [ Qaf p 302 ],
[ WrC ziyān ] |
| Tyr i (+fjord | ⭮ | ŧ u:l+an | ≡ | längs + zweifach | +an Endsilbe für 2fach | [ Langenscheidt's
Internetübersetzung] |
| Hole ← hóll | ⭮ | ha i l | ≡ | aufgehäuft (Sand, Erde) | von einem Hof auf
/ bei einem Hügel | [ WrC hail ] |
| herleiten, die sich dann im Laufe der Zeit nur leicht, aber auch treffend verschoben haben
− in rein norwegisches Svinge + rud ≡ Umkehrpunkt+Lichtung , bzw.
− mit r ↔ l in den Namen des Gottes des Kampfes Tyr, als die alte megalithische Sprache nicht mehr verstanden wurde, aber noch ein Hauch der Erinnerung an die sakrale Rolle des Ortes vorhanden war, und die Verzweifachung an diesem langen, geraden Ufer mit anschließender Durchsegelung des Fjords nach Svingerud Sinn macht,
− und jeder Hügel und jede Bodenweelle dieser Gegend durcheuchtet werden müßte.
Auch am deutschen Harzhorn findet man in knapp über 3 km Luftlinie entfernt vom ausgedehnten Kampfplatz zwei Ortsnamen, die beide auf ein Kampfgeschehen hindeuten
− nordostnördlich I l de hausen und westsüdwestlich W i ers hausen. |
semantisch ähnliche Herleitungen dieses angeblich germanischen aber in beiden Silbentrennungen auch semiti(di)sch klingenden Namens, den wir deshalb auf dem Gebiet der Megalithkultur annehmen müssen, vielleicht sogar an dessen Südgrenze. Der Ort, den die Übersetzung - Scheinangriff - am besten beschreibt, ist − das Harzhorn !
Dies wirft Fragen nach Raum, also Ort, und Zeit auf: Man muß annehmen, daß der Feldzug des Germanicus 16 nChr das gesamte Gebiet, das Drusus weiland durchzogen hatte, abdeckte - also bis an die Elbe als Ostgrenze der geplanten Provinz Germania Magna. Die beiden neuentdeckten Marschlager Hannover-Wilkenburg und Hachelbich zeigen, daß römische Heerführer die gesamte Umgebung des Harzes sehr gut kannten.
Der Rückweg von dort an den Rhein, zunächst also an die Lippe und wie Tiberius weiter per Schiff, ist dann der kürzeste und bequemste, während ein kleiner Teil der 8 Legionen vom Lager bei Wilkenburg aus durch den Engpaß zwischen Oberesch und dem Knüppeldamm durch das Moor um Barenaue zur Flottenstation bei Rheine an die Ems geschickt wurde – ein Ablenkungsmanöver.
Bei der Frage nach der Zeit müssen wir sogar 1000 Jahre überbrücken: Wenn Zonares 1000 Jahre später verblüffende Einzelheiten über die Clades Variana niederschreibt, kann das nur bedeuten, daß er schriftliche Aufzeichnungen zur Verfügung hatte, die heute nicht mehr vorhanden sind - vermutlich in den Bibliotheken von Alexandria und Konstantinopel vernichtet. Der Erfinder dieser Wehrmachtsberichte war Julius Cäsar, die Flußfahrten dienten ihrem Studium und der Festlegung einer Strategie durch den Generalstab. Die der Clades Variana standen selbstverständlich auch Germanicus und den severischen Kaisern 200 Jahre später zur Verfügung.
Den Germanen stand dagegen nichts dergleichen zur Verfügung, und deshalb waren sie von Beginn an der römischen Militärmaschine unterlegen. Insbesondere konnten sie nichts von dem Ausfall der Katapulte des Varus durch den Dauerregen wissen und waren deshalb der römischen Artillerie ausgeliefert. Bauten sie eine Falle auf, die dann für sie selbst zur Falle wurde? Den Durchmarsch der Legionen durch die Talenge am Harzhorn konnten sie so nicht aufhalten.
Es bleibt zu verstehen, wie ein solcher Name - Idistaviso - aus einer zur Zeit der Römer längst vergessenen, völlig fremden Sprache überleben konnte. Im Falle des *vaskonischen Anteils der germanischen Sprache haben wir das durch das Überleben der *Vaskonen in den Bergen Mitteleuropas erklärt und das Ende ihrer letzten Eigenständigkeiten auf das Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 datiert. Die megalithische Sprache ist aber schon um 800 v Chr untergegangen - mit Ausnahme einiger Enklaven - und hat nur im Land der Pikten noch länger überlebt. Mit dieser Etymologie muß es folglich am Harzhorn schon vorher zu strategisch vergleichbaren Kämpfen gekommen sein, etwa schon zwischen ansässigen Bandkeramikern und vordringenden Megalithikern oder - wahrscheinlicher - zwischen Megalithikern und Indogermanen. | Arminius
gegen
Germanicus
mit 8 Legionen
und etwa
90 000 Mann
—
uralte Überlegungen
Paul Höfers
ergänzt
durch eine sehr frühe
megalithische
Etymologie
und
die Annahme einer
römischen
Kriegsberichterstattung
—
es bleibt,
die Runeninschrift von
Svingerud
vollständig zu lesen
und
zu übersetzen |
Google
Earth | Was sagt GoogleEarth dazu, das als Quelle unverzichtbar geworden ist? Für die Archäologie kann der Blick von oben Beweise liefern – Gegenbeweise nicht unbedingt: Nach langer Zeit können sichtbare Spuren durch Verwitterung, Bewaldung, Überbauung oder Bewirtschaftung verschwunden sein. Auf der Habenseite ist zu verbuchen, daß Grundrisse auch nach langer landwirtschaftlicher Nutzung sichtbar bleiben können. Und nicht zuletzt – man braucht nicht mehr irgendjemand zu bemühen ( und bezahlen ) wenn man Aufnahmen von oben veröffentlichen will. Leider sind einige der oben erwähnten Ansichten aus GoogleEarth nicht in Webseiten einbettbar.
GoogleEarth arbeitet im sichtbaren elektromagnetischen Spektrum! Es gibt aber auch Radaraufnahmen der Erdoberfläche, z.B. bei der ESA!
Das Gegenteil einer Danksagung muß hier auch erwähnt werden: Autoren wie [ Büc ], [ Le i ], [ Spa ] und [ Ven ] werden bei Besprechungen oft hemmungslos kritisiert. Offensichtlich lösen weitreichende Theorien und Gesamtdarstellungen, wahrscheinlich weil der Stallgeruch fehlt, Aggressionen aus, die zu fast zügelloser Unlogik führen. Und wer die Existenz der Römerlager in Kesseler und Cappel bezweifelt, muß sehr treffende Gegenargumente vorweisen – nach den Ausgrabungen in Oberaden, Anreppen und jetzt auch in Olfen - ganz zu schweigen von den entfernteren in Hannover-Wilkenburg, Hachelbich und bei den Externsteinen - hat er die Wahrscheinlichkeit gegen sich. | |
| Klocks i n | | | |